„Biographische Skizzen moderner Musiker XXIX. Béla Bartók (Selbstbiographie)”, Musikpädagogische Zeitschrift, Organ des Österreichischen Reichsverbandes, VIII/11–12 (1918. november–december), 97–99.
Gyűjteményes kiadás: DocB/2, 113–116.; BÖI, 816–818.; BBI/1, 27–30.
További verzió: Béla Bartók (Selbstbiographie)
Forrás: BBA
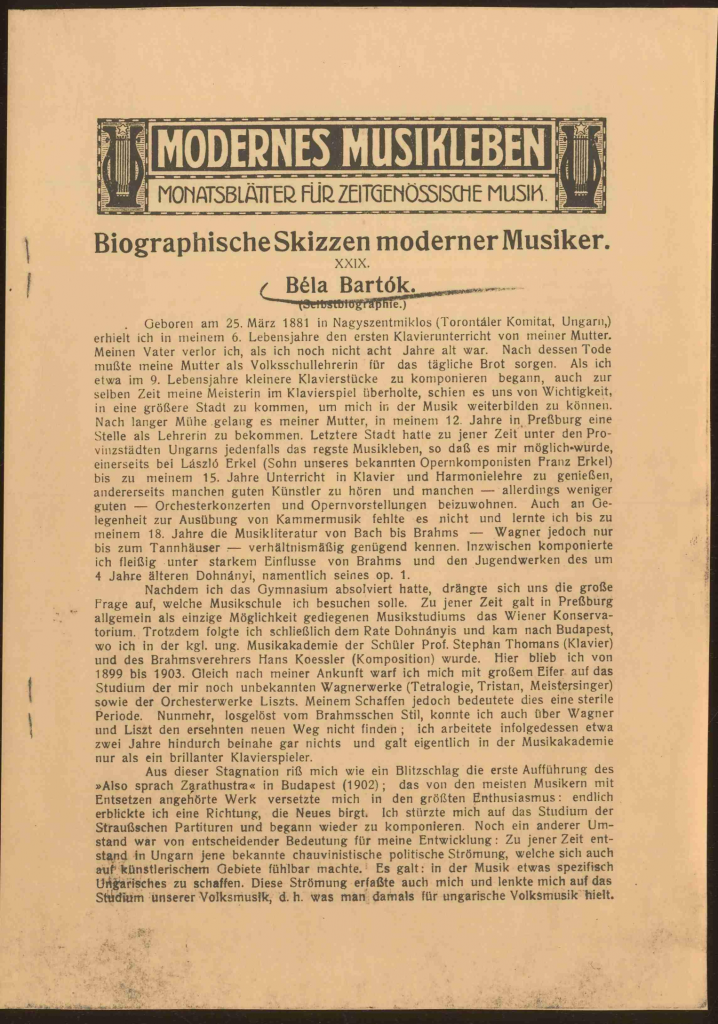
Biographische Skizzen moderner Musiker.
XXIX.
. Geboren am 25. März 1881 in Nagyszentmiklós (Torontáler Komitat, Ungarn,) erhielt ich in meinem 6. Lebensjahre den ersten Klavierunterricht von meiner Mutter. Meinen Vater verlor ich, als ich noch nicht acht Jahre alt war. Nach dessen Tode mußte meine Mutter als Volksschullehrerin für das tägliche Brot sorgen. Als ich etwa im 9. Lebensjahre kleinere Klavierstücke zu komponieren begann, auch zur selben Zeit meine Meisterin im Klavierspiel überholte, schien es uns von Wichtigkeit, in eine größere Stadt zu kommen, um mich in der Musik weiterbilden zu können. Nach langer Mühe gelang es meiner Mutter, in meinem 12. Jahre in Preßburg eine Stelle als Lehrerin zu bekommen. Letztere Stadt hatte zu jener Zeit unter den Provinzstädten Ungarns jedenfalls das regste Musikleben, so daß es mir möglich-wurde, einerseits bei László Erkel (Sohn unseres bekannten Opernkomponisten Franz Erkel) bis zu meinem 15. Jahre Unterricht in Klavier und Harmonielehre zu genießen, andererseits manchen guten Künstler zu hören und manchen — allerdings weniger guten — Orchesterkonzerten und Opernvorstellungen beizuwohnen. Auch an Gelegenheit zur Ausübung von Kammermusik fehlte es nicht und lernte ich bis zu meinem 18. Jahre die Musikliteratur von Bach bis Brahms — Wagner jedoch nur bis zum Tannhäuser — verhältnismäßig genügend kennen. Inzwischen komponierte ich fleißig unter starkem Einflüsse von Brahms und den Jugendwerken des um 4 Jahre älteren Dohnányi, namentlich seines op. 1.
Nachdem ich das Gymnasium absolviert hatte, drängte sich uns die große Frage auf, welche Musikschule ich besuchen solle. Zu jener Zeit galt in Preßburg allgemein als einzige Möglichkeit gediegenen Musikstudiums das Wiener Konservatorium. Trotzdem folgte ich schließlich dem Rate Dohnányis und kam nach Budapest, wo ich in der kgl. ung. Musikakademie der Schüler Prof. Stephan Thomans (Klavier) und des Brahmsverehrers Hans Koessler (Komposition) wurde. Hier blieb ich von 1899 bis 1903. Gleich nach meiner Ankunft warf ich mich mit großem Eifer auf das Studium der mir noch unbekannten Wagnerwerke (Tetralogie, Tristan, Meistersinger) sowie der Orchesterwerke Liszts. Meinem Schaffen jedoch bedeutete dies eine sterile Periode. Nunmehr, losgelöst vom Brahmsschen Stil, konnte ich auch über Wagner und Liszt den ersehnten neuen Weg nicht finden ; ich arbeitete infolgedessen etwa zwei Jahre hindurch beinahe gar nichts und galt eigentlich in der Musikakademie nur als ein brillanter Klavierspieler.
Aus dieser Stagnation riß mich wie ein Blitzschlag die erste Aufführung des »Also sprach Zarathustra« in Budapest (1902); das von den meisten Musikern mit Entsetzen angehörte Werk versetzte mich in den größten Enthusiasmus: endlich erblickte ich eine Richtung, die Neues birgt. Ich stürzte mich auf das Studium der Straußschen Partituren und begann wieder zu komponieren. Noch ein anderer Umstand war von entscheidender Bedeutung für meine Entwicklung: Zu jener Zeit entstand in Ungarn jene bekannte chauvinistische politische Strömung, welche sich auch auf künstlerischem Gebiete fühlbar machte. Es galt: in der Musik etwas spezifisch Ungarisches zu schaffen. Diese Strömung erfaßte auch mich und lenkte mich auf das Studium unserer Volksmusik, d. h. was man damals für ungarische Volksmusik hielt.
Unter diesen beiden Einflüssen komponierte ich im Jahre 1903 eine sinfonische Dichtung, betitelt: »Kossuth«, welche Hans Richter sofort zur Aufführung in Manchester annahm (Februar 1904). Zu dieser Zeit entstand noch eine Violinsonate und ein Klavierquintett, erstere durch Fitzner in Wien, letzteres durch das Prillquartett aufgeführt. Diese drei Werke blieben unveröffentlicht. Mit der im Jahre 1904 entstandenen Rhapsodie für Klavier und Orchester, op. 1, warb ich im Jahre 1905 in Paris ohne Erfolg um den Rubinsteinpreis; sie wurde 1909 in Budapest und 1910 am Züricher Tonkünstlerfest des allgemeinen deutschen Musikvereines zur Aufführung gebracht. Die 1905 komponierte I. Suite für großes Orchester erlebte ihre Uraufführung im November 1905 unter Ferdinand Loewes Leitung in Wien.
Bald sah ich jedoch ein, daß die irrtümlicherweise als Volkslieder bekannten ungarischen Weisen — die jedoch Kompositionen der dem Herrenstande angehörigen Komponisten sind — wenig Interesse bieten, so daß ich mich im Jahre 1905 der Erforschung der bis dahin schlechtweg unbekannten ungarischen Bauernmusik zuwandte. Hiebei fand ich zu meinem großen Glücke einen ausgezeichneten Musiker zum Mitarbeiter, Zoltán Kodály, dessen Scharfsinn und Urteilskraft, mir auf jedem Gebiete der Musik so manchen unschätzbaren Wink und Ratschlag erteilte.
Die Forschung begann ich vom rein musikalischem Gesichtspunkte aus und nur auf magyarischem Sprachgebiete, später jedoch gesellte sich die nicht minder wichtige wissenschaftliche Behandlung des Materials dazu, und die Erstreckung der Forschung auf die Sprachgebiete der Slowaken und Rumänen.
Die Verarbeitung des musikalisch höchst wertvollen Materials war deshalb von entscheidender Bedeutung für mich, da sie eine vollständige Emanzipation von der Alleinherrschaft des bisherigen Dur- und Mollsystems bedeutete. Denn der weit überwiegende und gerade wertvollere Teil des gewonnenen Melodienschatzes ist in den Kirchentonarten, resp. in altgriechischen und gewissen noch primitiveren (namentlich pentatonischen) Tonarten gehalten und zeigt außerdem mannigfaltigste und freieste Rhythmusgebilde und Taktwechsel sowohl im rubato als auch im tempo giusto Vortrag. Es erwies sich, daß die alten, in unserer Kunstmusik nicht mehr gebrauchten Tonleitern ihre Lebensfähigkeit noch durchaus nicht verloren haben. Die Anwendung derselben ermöglichte auch harmonisch neuartige Kombinationen. Diese freie Behandlung der diatonischen Tonreihe wies auf eine Möglichkeit zur Befreiung von der erstarrten Dur-moll-Skala hin und führte als letzte Konsequenz zur vollkommen freien Verfügung über die einzelnen Töne unseres chromatischen Zwölftonsystems. — Meine im Jahre 1907 erfolgte Ernennung zum Professor an der königl. ungar. Musikakademie zu Budapest war mir deshalb willkommen, weil sie mir die Niederlassung in Ungarn ermöglichte und ich so meine folkloristischen Ziele weiterhin verfolgen konnte. Als ich noch im selben Jahre auf Anregung Kodálys die Werke Debussys kennen lernte und studierte, nahm ich mit Erstaunen wahr, daß auch in dessen Melodik gewisse, unserer Volksmusik ganz analoge pentatonische Wendungen eine große Rolle spielen. Zweifelsohne sind dieselben ebenfalls dem Einflusse irgendeiner osteuropäischen Volksmusik — wahrscheinlich der russischen — zuzuschreiben. Gleiche Bestrebungen findet man in den Werken Igor Strawinskys; unsere Zeit weist also auch in den voneinander entferntesten geographischen Gebieten dieselbe Strömung auf: Die Kunstmusik mit Elementen einer frischen, durch das Schaffen der letzten Jahrhunderte nicht beeinflußten Bauernmusik zu beleben.
Zu Anfang dieser Periode entstand die II. Suite für kleine Orchester (op. 4, 1907), 2 Porträts für kleines Orchester (op. 5, 1908), ferner 1908 — 1910 eine Anzahl von Klavierstücken, das 1. Streichquartett op. 7 (aufgeführt u. a. in Wien, Berlin, Paris) und »2 Images« für großes Orchester op. 10 (aufgeführt in Zürich, Berlin). Im Jahre 1911 schrieb ich mein erstes Vokal- und Bühnenwerk, die einaktige Oper »Die Burg des Herzogs Blaubart« (Text von Béla Balázs), welche jedoch aus verschiedenen Gründen sieben Jahre unaufgeführt blieb. In 1913 forderte mich der Intendant der königl. ungar. Oper, Graf Nikolaus Bánffy auf, zu dem Tanzspiele Béla Balázs’: »Der holzgeschnitzte Prinz« die Musik zu schreiben. Das Werk vollendete ich erst 1916; die Uraufführung fand unter Leitung unseres ausgezeichneten Kapell-
meisters Egisto Tango, der dem Werke das wärmste Interesse entgegenbrachte, am 12. Mai 1917 in Budapest statt, worauf Graf Bánffy auch meine Oper zur Aufführung annahm. (Uraufführung letzterer am 24. Mai 1918.)
Während dieser Zeitperiode setzte ich meine folkloristische Arbeit unaufhörlich fort; unter anderem unternahm ich im Juni 1913 eine Reise in die Oasen der Biskri (Araber der Umgebung Biskras in Algerien). Aus meiner nunmehr viele Tausende von Melodien umfassenden Sammlung erschienen bis jetzt nur 350 rumänische Volkslieder, herausgegeben von der Bukarester rumänischen Akademie der Wissenschaften (1913). Die mit Kodály gemeinsam geplante Herausgabe des magyarischen Materials verhinderte vorläufig der Weltkrieg. Während desselben wurden wir durch das k. u. k. Kriegsministerium mit der Sammlung und Herausgabe der ungarländischen Soldatenlieder betraut. Als erste Veröffentlichung ist zurzeit ein Bändchen: »100 ungarische Soldatenlieder« in Druck (Universal-Edition). Auch wurde ich an dem am 12. Jänner 1918 vom k. u, k. Kriegsministerium in Wien veranstalteten »Historischen Konzert« mit der Leitung des ungarischen Teiles betraut.
Musik und Volkswirtschaft.*)
Der Krieg hat uns gelehrt, alle Dinge von ihrer wirtschaftlichen Seite aus anzusehen ; auch die Kunst wird sich eine starke Bemessung nach materiellen Werten gefallen lassen müssen. Zwar hat man schon früher immer wiederholt, daß die Kunst nach Brot gehe, war aber damit zufrieden, sich die großen Honorare zuzuraunen, die einzelne, und zwar meistens reproduzierende Künstler erhalten, hat sich jedoch nicht darum bekümmert, daß viele kleine Künstler gleichzeitig verhungerten. Noch weniger hat man sich darüber Gedanken gemacht, was die Kunst und der Kunstbetrieb für die allgemeine Volkswirtschaft bedeuten. Ich möchte daher die Aufmerksamkeit auf gewisse wirtschaftliche Begleiterscheinungen des Kunstlebens zu lenken versuchen.
Die wirtschaftliche Kraft eines Landes wird nicht ausschließlich durch Momente, die dem normalen Wirtschaftsleben angehören, sondern auch durch außerhalb desselben stehende Faktoren, die idealer Natur sind, bestimmt. Hierher gehört beispielsweise alles, was man unter dem Namen »Hebung des Fremdenverkehrs« zusammenfaßt. Die Bestrebungen zur Hebung des Fremdenverkehrs nehmen jetzt richtigerweise ihren Ausgang nicht mehr bloß von den Naturschönheiten des Landes, sondern immer mehr und mehr von kulturellen Erscheinungen. Die wichtigste, weil allgemeinste, darunter ist das Kunstleben und für uns in Deutsch-Oesterreich mit seiner uralten musikalischen Tradition die Musik. Das meiste, was für die Musik gilt, wird für die bildenden und redenden Künste gewiß nicht zutreffen, aber eine Betrachtung der Zusammenhänge zwischen Musikleben und Volkswirtschaft dürfte für die anderen Künste ähnliche Erwägungen hervorrufen. Hier soll insbesondere dafür plädiert werden, bei allen Fragen der Uebergangswirtschaft die Tonkunst und jene Summe von Erscheinungen, die wir Musikleben nennen, nicht außer, acht zu lassen. Die Tonkunst kann, ohne daß sie hierbei herabgewürdigt wird, unserer Volkswirtschaft recht gut nutzbar gemacht werden, zumindestens soll vermieden werden, daß sie eine Passivpost in unserem allgemeinen Budget bildet. Es ist in Fachkreisen bekannt, daß wir in den letzten Jahren vor dem Kriege auf musikalischem Gebiete sozusagen eine passive Handelsbilanz hatten. Der Import überstieg bei weitem unseren Export, während dies in früheren Zeiten umgekehrt war. Ein großer Teil der in Wien konzertierenden Künstler, speziell jener, die »ziehen«, daher hohe Honorare erhalten, kam aus dem Ausland. Dies bedeutet gewiß eine wirtschaftliche Schädigung für uns. Ich will nun gewiß nicht etwa einem musikalischen Schutzzoll das Wort reden; ich weiß wohl zu würdigen, wieviel Anregung auch durch die reproduzierenden Künstler dem künstlerischen Schaffen gegeben wird. Aber eine gewisse Einschränkung des hypertrophischen Virtuosenimports und seiner Begleiterscheinungen möchte ich doch befürworten. Es sind nicht vielleicht die hohen Honorare allein, um die es sich hier handelt ; im Vergleich zu den hohen Summen, die jetzt ins Ausland fließen müssen,
*) Mit Benützung eines vor einiger Zeit in einer Wiener Tageszeitung erschienenen Artikels.