“Das Problem der neuen Musik”, Melos, I/5 (16 April 1920), 107–110.
Collected edition: BÖI, 718–722; Essays, 455–459; DocB/5, 23–33 (edition of two autograph drafts)
Source: ÖNB
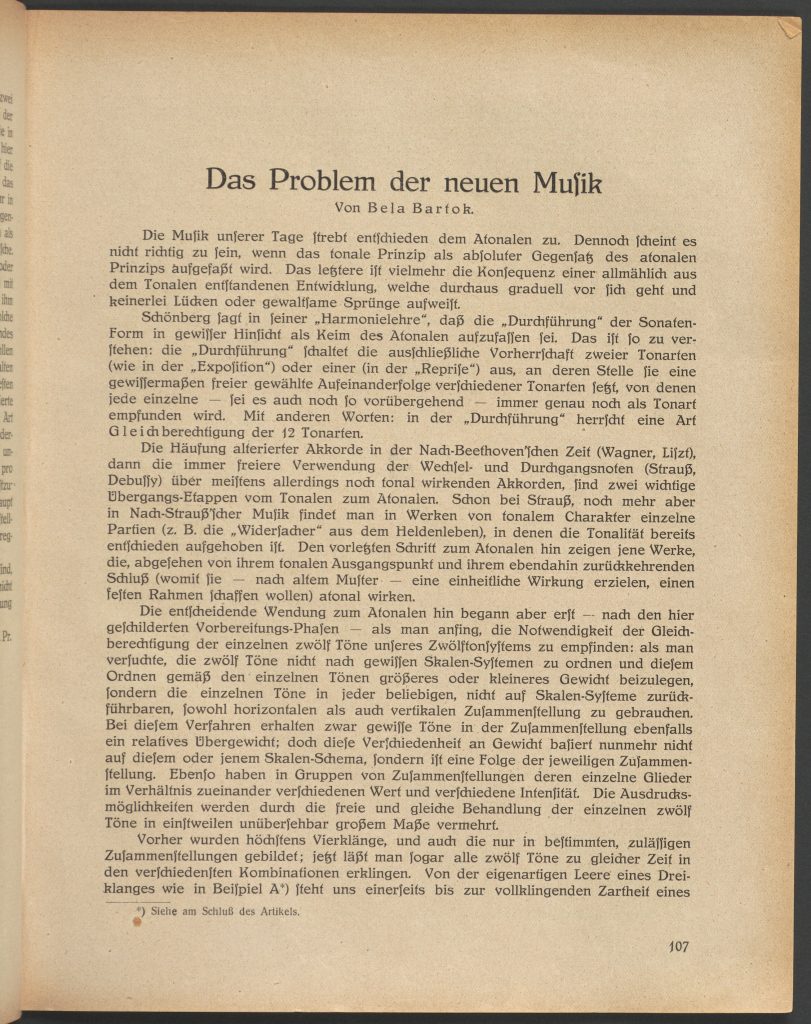
Das Problem der neuen Musik
Von Bela Bartók.
Die Musik unserer Tage strebt entschieden dem Atonalen zu. Dennoch scheint es nicht richtig zu fein, wenn das tonale Prinzip als absoluter Gegensatz des atonalen Prinzips aufgefaßt wird. Das letztere ist vielmehr die Konsequenz einer allmählich aus dem Tonalen entstandenen Entwicklung, welche durchaus graduell vor sich geht und keinerlei Lücken oder gewaltsame Sprünge aufweist.
Schönberg sagt in seiner „Harmonielehre“, daß die „Durchführung“ der Sonaten- Form in gewisser Hinsicht als Keim des Atonalen aufzufallen sei. Das ist so zu verstehen: die „Durchführung“ schaltet die ausschließliche Vorherrschaft zweier Tonarten (wie in der „Exposition“) oder einer (in der „Reprise“) aus, an deren Stelle sie eine gewissermaßen freier gewählte Auseinanderfolge verschiedener Tonarten jetzt, von denen jede einzelne — sei es auch noch so vorübergehend — immer genau noch als Tonart empfunden wird. Mit anderen Worten: in der „Durchführung“ herrscht eine Art G 1 e i ch berechtigung der 12 Tonarten.
Die Häufung alterierter Akkorde in der Nach-Beethoven’schen Zeit (Wagner, Liszt), dann die immer freiere Verwendung der Wechsel- und Durchgangsnoten (Strauß, Debussy) über meistens allerdings noch tonal wirkenden Akkorden, find zwei wichtige Übergangs-Etappen vom Tonalen zum Atonalen. Schon bei Strauß, noch mehr aber in Nach-Strauß’scher Musik findet man in Werken von tonalem Charakter einzelne Partien (z. B. die „Widersacher“ aus dem Heldenleben), in denen die Tonalität bereits entschieden aufgehoben ist. Den Vorletzten Schritt zum Atonalen hin zeigen jene Werke, die, abgesehen von ihrem tonalen Ausgangspunkt und ihrem ebendahin zurückkehrenden Schluß (womit sie — nach altem Muster — eine einheitliche Wirkung erzielen, einen festen Rahmen schaffen wollen) atonal wirken.
Die entscheidende Wendung zum Atonalen hin begann aber erst — nach den hier geschilderten Vorbereitungs-Phasen — als man anfing, die Notwendigkeit der Gleichberechtigung der einzelnen zwölf Töne unseres Zwölftonsystems zu empfinden: als man versuchte, die zwölf Töne nicht nach gewissen Skalen-Systemen zu ordnen und diesem Ordnen gemäß den einzelnen Tönen größeres oder kleineres Gewicht beizulegen, sondern die einzelnen Töne in jeder beliebigen, nicht auf Skalen-Systeme zurück- führbaren, sowohl horizontalen als auch vertikalen Zusammenstellung zu gebrauchen. Bei diesem Verfahren erhalten zwar gewisse Töne in der Zusammenstellung ebenfalls ein relatives Übergewicht; doch diese Verschiedenheit an Gewicht basiert nunmehr nicht auf diesem oder jenem Skalen-Schema, sondern ist eine Folge der jeweiligen Zusammenstellung. Ebenso haben in Gruppen von Zusammenstellungen deren einzelne Glieder im Verhältnis zueinander verschiedenen Wert und verschiedene Intensität. Die Ausdrucksmöglichkeifen werden durch die freie und gleiche Behandlung der einzelnen zwölf Töne in einstweilen unübersehbar großem Maße vermehrt.
Vorher wurden höchstens Vierklänge, und auch die nur in bestimmten, zulässigen Zusammenstellungen gebildet; jetzt läßt man sogar alle zwölf Töne zu gleicher Zeit in den verschiedensten Kombinationen erklingen. Von der eigenartigen Leere eines Dreiklanges wie in Beispiel A*) steht uns einerseits bis zur vollklingenden Zartheit eines
*) Siehe am Schluß des Artikels.
Mehrklanges Wie in Beispiel B) und andererseits bis zur schrillen Wucht eines Mehrklangs wie in Beispiel C) ein nie geahnter Reichtum an Übergangs-Nuancen zur Verfügung. Die engsten Lagen von drei und mehreren benachbarten Tönen wirken je nach der Tiefe, bezw. Höhe der Lage als mehr oder minder dicht klingendes, „stilisiertes“ Geräusch. Die in tieferen Registern angewandte weniger enge Lage wie in Beispiel D*) nähert sich im Klang dieser geräuschartigen Wirkung; um zwei Oktaven höher gesetzt verändert sich aber ihr Charakter und wird ätherischer: die Wirkung nähert sich dann der des Akkordbeispieles B.
Bei homophoner Musik arbeitet man sozusagen mit gleichzeitig, oder in mehr oder minder raschem Nacheinander erklingenden Tonmassen, mit dichteren oder luftigeren, massiveren oder dünneren Tonflecken, welche Qualitäten durch die Zahl der angewandten Töne, durch die absolute Lage und die relative (d. h. weitere oder engere Lage) usw. bedingt find. Durch diese Tonflechen, denen — je nach der Art ihrer Zusammen- stellung — verschieden graduierte Intensität innewohnt und deren einzelne Töne je nach ihrer Rolle in der senkrechten Tongruppe — verschiedene Bedeutung haben, wird in der atonalen Musik in Folge eben dieser Verschiedenheiten der Entwurf der „Linie“ ermöglicht. Inwieweit die Erhebungen und Senkungen dieser Linie dann ein harmonisches Ganzes darstellen oder nicht, davon allein hängt die Formvollendung des betreffenden Werkes ab.
Die Wucht des durch Worte schwer präzisierbaren Inhaltes, die Frische der um Schönberg’s Wort zu gebrauchen — „ersten Eingebung“, die Harmonie der Linienführung: diese drei Faktoren ergeben das Kunstwerk. Aber waren diese Faktoren bei den älteren Kunstwerken der Musik denn nicht ebenso vorhanden? Die Haupt- erfordernisse haben sich durchaus nicht verändert, eine Änderung liegt nur in der Art des Gebrauchs der Mittel: in der Vergangenheit arbeitete man mit beschränkteren, jetzt mit ausgedehnteren Möglichkeiten. Die Zukunft wird uns darüber zu belehren haben, ob das freie Walten über reichere Möglichkeiten zu ebenso großen Kunstwerken führt, als von den Musikern der Vergangenheit geschaffen worden find.
Bei der Betrachtung atonaler Musik verwirrt sehr, daß man für das Feststellen des Befriedigenden, des Harmonischen in der Linienführung, keinen in Worte ausprägbaren Anhaltspunkt, keine „Regeln“ besitzt. In dieser Hinsicht find sowohl die Komponisten als auch die Zuhörer nur auf ihren Instinkt angewiesen. Die Zeit zur Feststellung eines Systems in unserer atonalen Musik ist überhaupt noch nicht da (in Schönberg’s Harmonielehre — S. 49 — finden sich einige interessante, wenn auch schüchterne Versuche dazu). Diese neueste Periode der Musikentwicklung hat ja kaum begonnen, und es liegen noch viel zu wenig Werke dieser Art vor, um bereits eine Theorie aufbauen zu können. Wenn diese mit der Zeit entstehen wird, kann sie für die Nachwelt doch nur dieselbe Bedeutung haben, wie seinerzeit jede der älteren Theorien: sie wird höchstens eine Grundlage fein, auf der man erweiternd fortbauen kann, um schließlich wieder zu irgend etwas gänzlich Neuem zu gelangen, das dann seinerseits wiederum zur Aufstellung einer neuen Theorie anregt.
Bezüglich der homophonen und polyphonen Richtung würde ich meinerseits für die Mischung beider Arten stimmen, also für ein Verfahren, welches mehr Mannigfaltigkeit gewährt als die ausschließliche Beschränkung auf eine der beiden Arten. Aus ähnlichen Gründen, und da es sich ja nicht um zwei ganz und gar einander entgegen-
■) Siehe am Schluß des Artikels.
108 •
gesetzte Prinzipien handelt’ scheint mir eine wohlerwogene (nicht allzu häufige) An- 9 Akk°rden älterer’ tonaler Phraseologie innerhalb atonaler Musik nicht
stilwirdig vereinzelter Dreiklang der diatonischen Skala, eine Terz, eine eine Quint oder Oktave inmitten atonaler Mehrklänge – allerdings nur an ganz
ferner erhalten diese durch langen erWecken noch keine Empfindung der Tonalität; ferner diese durch langen Gebrauch und Mißbrauch bereits welkgewordenen in neuen Umgebung eine frische, besondere Wirkungskraft, die Dreiklänge den Gegensatz entsteht. Ja, man würde sogar ganze Folgen derartiger empfinden. falls dieselben nicht tonal wirken – als durchaus stilgemäß unbedingte Ausschaltung dieser älteren Klänge würde den Verzicht auf
unserer unbedeutenden – Teil der Mittel unserer Kunst bedeuten; das Endziel lerer Bestrebungen ist jedoch die unbeschränkte und vollständige Ausnutzung des ganzen vorhandenen, möglichen Tonmaterials. Selbstverständlich aber find gewisse Ver- derartiger Klänge, namentlich an den Tonika-Dominant Wechsel mahnende kordfolgen der heutigen Musik ganz und gar zuwider. (Man begegnet letztere wohlvermummt unter einem prunkvollen Dissonanzen-Gewand in manchen Werken, die außerst bestrebt sind, modern zu sein; solche Werke haben jedoch innerlich eigentlich wenig mit den neuen Bestrebungen zu schaffen).
Die Befürchtung’ daß atonale Musikwerke infolge des Aufgebens des auf das tonale System gegründeten symmetrischen Aufbaues eine formlose Masse darstellen wurden, ist nicht berechtigt. Erstens ist ein architektonischer, oder dem ähnlicher Aufbau nicht unbedingt notwendig; es würde der durch die den aneinandergereihten Ton- . gruppen innewohnenden differenzierten Intensitätsgrade entstandene Linienbau voll- ständig genügen. (Diese Art der Formbildung zeigt eine entfernte Analogie zur Formbildung der in ungebundener Rede abgefaßten Werke.) Zweitens aber schließt die atonale Musik gewisse äußere Mittel der Gliederung, gewiffe Wiederholungen (in anderer Lage; mit Veränderungen usw.) von bereits Gesagtem, Sequenzfolge, refrain-artige Wiederkehr mancher Gedanken, oder das Zurückkehren beim Schluß auf den Ausgangspunkt, nicht aus. All dieses Verfahren erinnert allerdings weniger an das Architektonisch- Symmetrische, als an den Versbau der gebundenen Rede.
Das Wesen der atonalen Musik auf dem System der Oberföne zu begründen, erscheint mir nicht zweckmäßig. Wohl kann die Verschiedenheit im Charakter und in der Wirkung der Intervalle durch das Phänomen der Oberföne erklärt werden, doch gibt dieses in der Frage der freien Anwendung der zwölf Töne einen nur wenig befriedigenden Aufschluß.
<$>
Der Entwicklungsprozeß zum Atonalen hin wäre vielleicht folgendermaßen auf- Zufassen: das mögliche Material der Musik besteht aus einer unendlichen Anzahl von Tönen verschiedener Höhe, vom tiefsten aufwärts bis zum höchsten vernehmbaren Tone, (Hier wollen wir Rhythmus, Klangfarbe und Dynamik — als bei der Erörterung der Frage nicht ausschlaggebende Elemente — unberücksichtigt lassen.) Unser ideales Ziel ist nun: immer mehr Bestandteile dieses Materials in Kunstwerken als Mittel zu verwerfen. Ursprünglich wurden auf Grund des Obertonsystems eine kleine Zahl von Tönen aus jener unendlichen Reihe als allein brauchbar ausgewählt: es wurde die diatonische Tonreihe gebildet, auf Grund des Obertonsystems in zwölf verschiedene Höhen transponiert und somit das ganze diatonische System gebildet. Bald stellte sich beim Drang ‘ nach Weiterentwicklung (nach freieren Modulationen) das Unzulängliche dieses Systems
heraus; man griff zur Gewalt und vergewaltigte die Natur durch die Zwölfteilung der Oktave; so entstand das künstliche, temperierte Zwölf-Tonsystem, dessen Fürsprecher und Verbreiter die Tasteninstrumente mit künstlicher Intonation waren. Doch das musikalische Denken bewegte sich trotz dieser gewaltigen Entfernung von der Natur jahr-
hundertelang auf diatonischem Boden, bis endlich, nach dem oben beschriebenen En – Wicklungsprozeß der musikalische Sinn für die gleiche Behandlung der einander gleichen 12 Halbtöne wach wurde. Dieses neue Verfahren birgt unermeßliche neue Möglichkeiten in sich, so daß Busoni’s Wunsch nach einem Drittel- oder Viertel-Tonsystem als vorzeitig erscheint. (Die feit dem Erscheinen seines „Entwurf einer neuen Ästhetik” entstandenen Werke Schönberg’s und Stravinsky’s beweisen, daß das Halbtonsystem noch nicht fein letztes Wort gesprochen hat). Die Zeit der Weiterteilung des halben Tons (vielleicht ins Unendliche?) wird jedenfalls kommen, wenn auch nicht in unseren Tagen, sondern in Jahrzehnten und Jahrhunderten. Doch wird sie ungeheure technische Schwierigkeiten, wie z. B. eine Neugestaltung des Baus der Taften- und der Klappeninstrumente zu überwinden haben, ganz abgesehen von den Intonationschwierigkeiten für die mensch- liche Stimme und all jene Instrumente, bei denen die Töne zum Teil durch Finger- aufsatz fixiert werden; dieser Umstand wird das Leben des Halbtonsystems höchst wahrscheinlich mehr, als künstlerisch notwendig ist, in die Länge ziehen.
Zum Schluß fei noch ein Wort über unsere Notenschrift gesagt. Sie entstand auf Grund des diatonischen Systems und ist eben deshalb zur schriftlichen Wiedergabe atonaler Musik eigentlich ein ganz ungeeignetes Werkzeug. Die Versetzungs- zeichen z. B. bedeuten eine Alterierung der diatonischen Stufen. Nun handelt es sich aber hier nicht um alterierte oder nichtalterierte diatonische Stufen, sondern um zwölf gleichwertige halbe Töne. Außerdem ist es recht schwierig, Konsequenz in der Schreibweife bei zubehalfen; off ist man z. B. darüber in Zweifel, ob man auf die leichtere Leserlichkeit in vertikaler oder horizontaler Richtung zu achten habe.
Es wäre wünschenswert, eine Notenschrift mit 12 gleichen Zeichen zur Verfügung zu haben, in welcher jeder der 12 Töne fein den anderen gleichwertiges Zeichen hätte, so daß nicht mehr manche Töne ausschließlich als Alterierungen anderer notiert werden müssen. Diese Erfindung jedoch harrt einstweilen noch des Erfinders.
Beispiele: